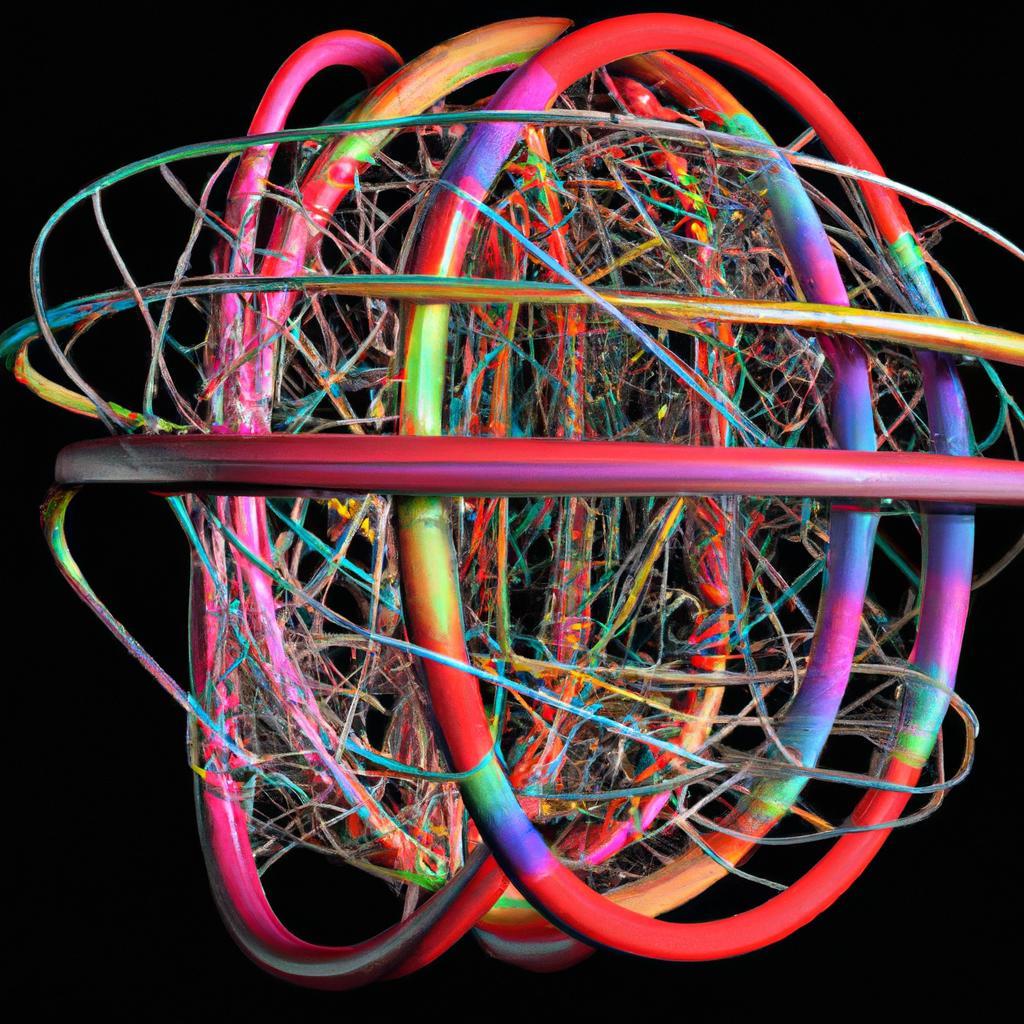Die Simulation von Schwingkreisen mit LTSpice, Multisim und ähnlichen Tools ermöglicht präzise Analysen von LC- und RLC-Netzwerken. Resonanzfrequenz, Güte und Dämpfung werden per AC- und Transientenanalyse sichtbar, Bode- und Zeitverläufe erleichtern das Design. Parameter-Sweeps, Monte-Carlo-Studien und Bauteiltoleranzen zeigen Robustheit und Effekte nichtidealer Komponenten.