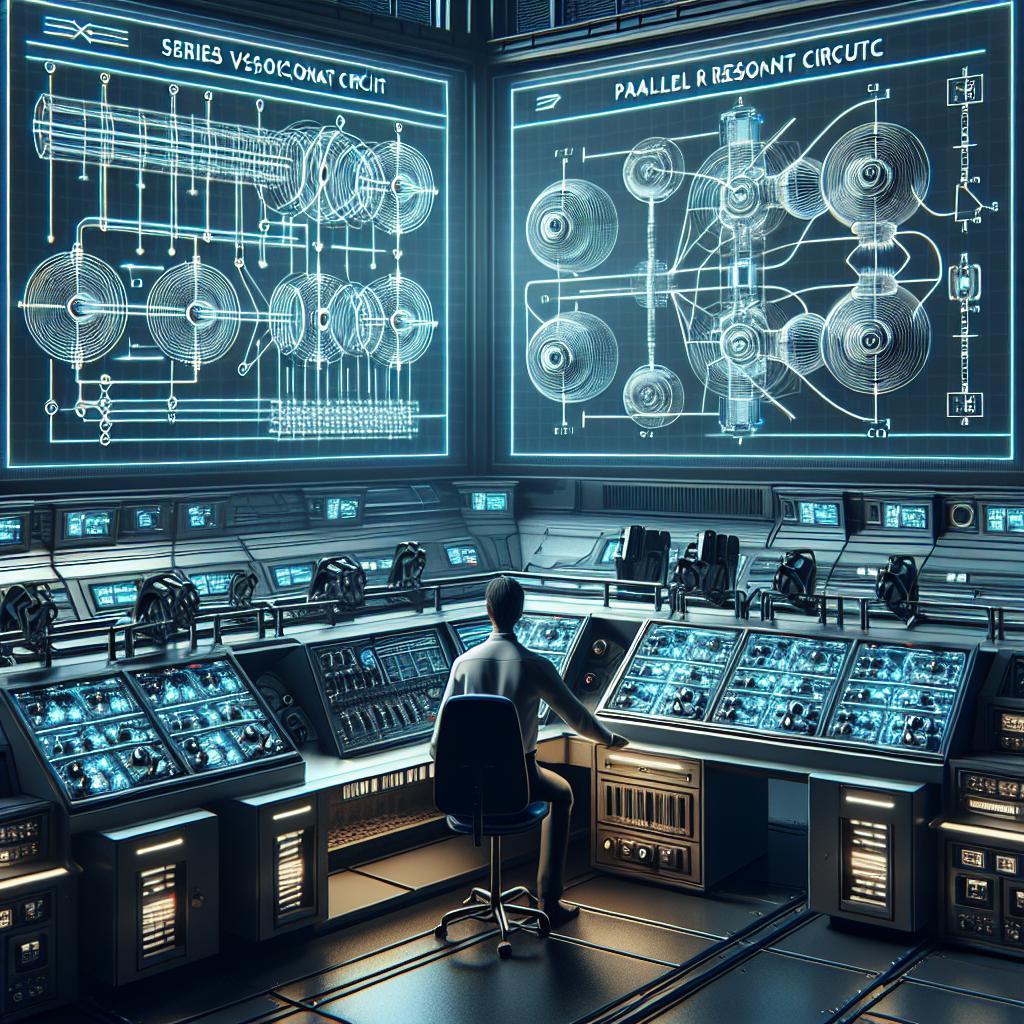Serien- und Parallelschwingkreise unterscheiden sich durch Strom- und Spannungsverteilung sowie Impedanzverlauf. Im Serienschwingkreis führt Resonanz zu minimaler Impedanz und maximalem Strom, im Parallelschwingkreis zu maximaler Impedanz und minimalem Strom. Anwendungen reichen von Filtern und Impedanzanpassung bis zu Schwingquarzen und Antennenabstimmung.