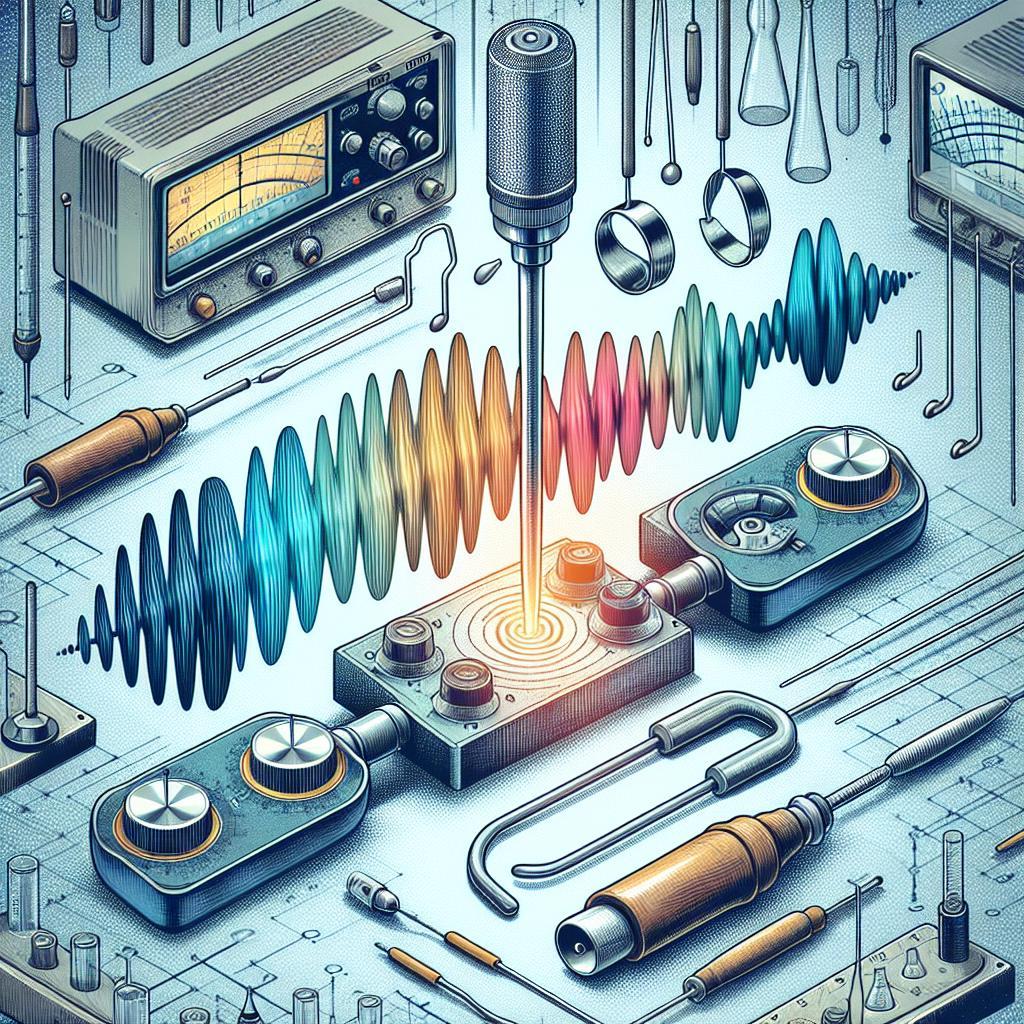Der Aufbau eines Schwingkreises gelingt mit sorgfältiger Auswahl von Spule und Kondensator, kurzen Leitungen und geringer parasitärer Kapazität. Zur Messung eignen sich Frequenzsweep mit Funktionsgenerator und Oszilloskop oder Netzwerkanalysator. Resonanzfrequenz und Güte lassen sich über Amplituden- und Phasengang bestimmen. Abschirmung, Masseführung und Kalibrierung minimieren Fehler.