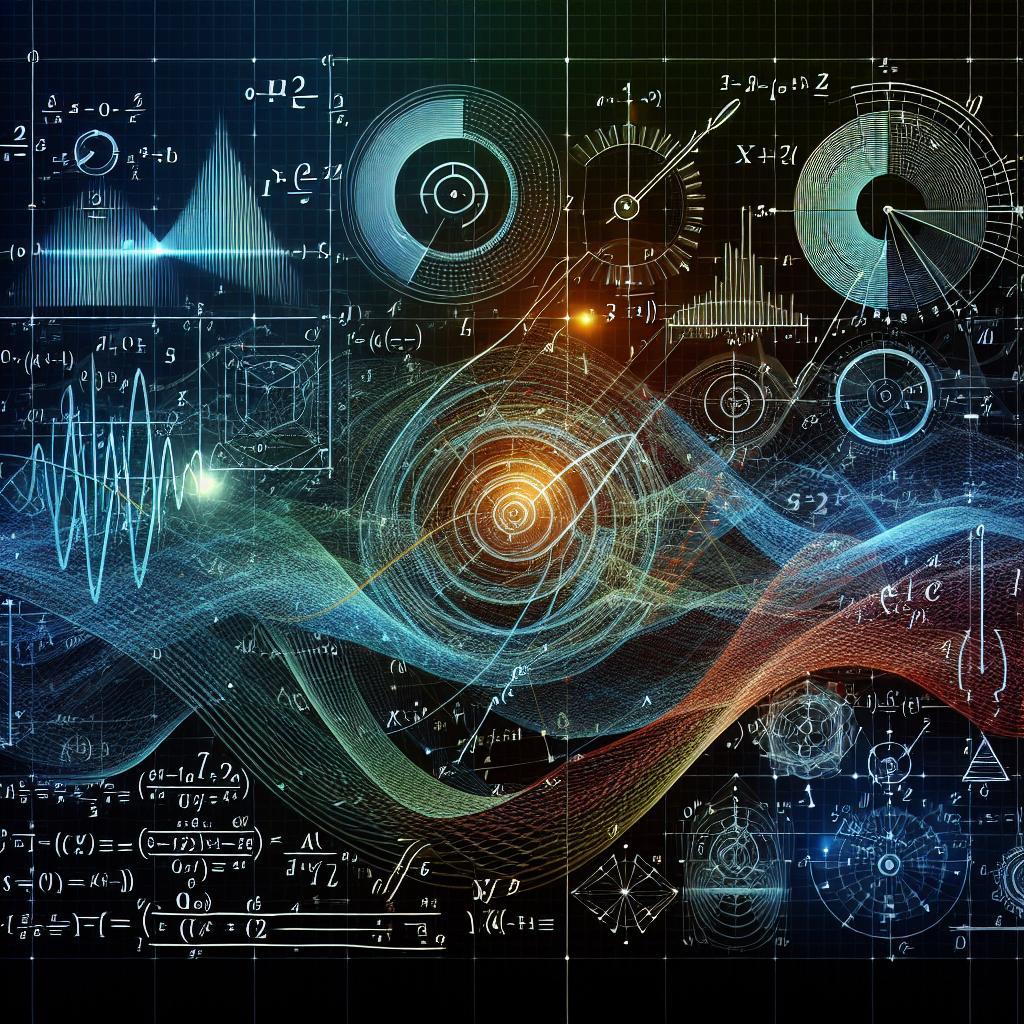Der Beitrag erläutert die mathematische Verknüpfung von Gütefaktor und Bandbreite in linearen Resonanzsystemen. Ausgehend von der Resonanzfrequenz f0 und der Halbwertsbreite Δf ergibt sich Q = f0/Δf. Zusätzlich wird die Rolle der Dämpfung beschrieben, die den Amplitudengang formt: Hohe Güte bewirkt schmale Bandbreite und steile Flanken, geringe Güte führt zu breiterem Durchlass.